Die #1 Strategie umsetzungs-Software: Lass deine Strategie nicht zu einem "what-if" werden
Optimiere deine strategische Planung und Ausführung mit KI-gestützten OKRs, KPIs und Ergebnismanagement, alles innerhalb einer Unternehmensplattform
.png)
WORKPATH Kunden
Mit unseren Experten und Partnern hat Workpath weltweit Unternehmen befähigt, ihre wichtigsten Ziele zu definieren und Strategie in Ergebnisse zu verwandeln.


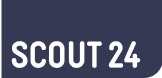



WARUM WORKPATH
ergebnisorientierten Unternehmensführung
All-In-One Training & Enablement
Als führender Anbieter für Enterprise Outcome Management bieten wir ein professionelles Serviceprogramm, das erstklassige Software mit Transformations-Know-how, Change Management und OKR-Training durch zertifizierte Experten kombiniert.
Integration mit angrenzenden Prozessen
Workpath verbindet all deine relevanten Steuerungsprozesse, Werkzeuge und Datenquellen in einem flexiblen System, um deine Teams nahtlos auf gemeinsame Zielvorgaben auszurichten.
Analytics auf Enterprise-Level
Wir bieten die umfangreichste Analytics Suite zur Überwachung deiner strategischen Planungs- und Ausführungsprozesse - rund um die OKRs und darüber hinaus. Flexible Berichtsmodule mit detaillierten Berichten ermöglichen individuelle Einblicke und kontinuierliche Kurskorrekturen.
Wir geben dir die Werkzeuge an die Hand, Strategieumsetzung und Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen zu verbessern.
Mehr erfahren.webp)
.png)

Nach vielen Jahren in verschiedenen Führungspositionen in der dynamischen Welt der Logistik bei DB Schenker habe ich gelernt, dass Erfolg nicht nur durch das Bewegen von Gütern, sondern auch durch das Bewegen von Köpfen entsteht. OKRs ermöglichen es uns, unsere Strategie umzusetzen, den Fokus von Outputs auf Outcomes zu verlagern und unsere Prioritäten nahtlos aufeinander abzustimmen. Durch die Kaskadierung dieser OKRs setzen wir das wahre Potenzial unserer internationalen Teams frei und verwandeln Bestrebungen in Erfolge auf jeder Strecke, die wir befahren.
Workpath DEMO
Bist du bereit, die Umsetzung deiner Strategie zu beschleunigen?
Demo buchenTHE WORKPATH WORLD OF CONTENT
Der umfassende OKR Guide
Sorge mit dem umfassenden OKR-Leitfaden von Workpath dafür, dass OKRs in deinem Unternehmen funktionieren. Checklisten, Beispiele, FAQs – alles Wissenswerte in einer Übersicht.

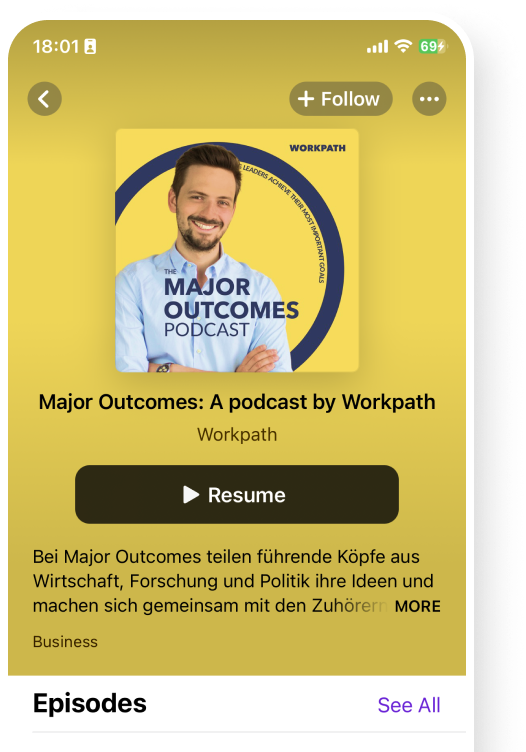
Der Major Outcomes Podcast
Hören führenden Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Forschung und Politik zu, wie sie Fragen zur Zukunft von Führung, Zusammenarbeit und Organisation diskutieren.
Das Workpath Magazin
Entdecke die neuesten Artikel zu Strategieumsetzung, OKRs und Transformation in der neuen Arbeitswelt. Trends, Experteninterviews, Fallstudien – alle Einblicke an einem Ort.

WORKPATH BLOG

workpath Demo
Buche eine Demo oder teste die Plattform 14 Tage lang kostenlos!

%20(1).jpg)
.png)
%20(1).png)


